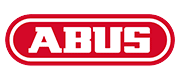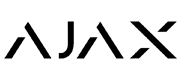1. Schweizweiter Überblick: Die Rückkehr eines alten Problems
Nach einem Jahrzehnt sinkender Einbruchszahlen erlebte die Schweiz 2023 eine deutliche Trendwende. Der Anstieg betrifft sowohl städtische als auch ländliche Regionen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Insgesamt wurden mehr als 45.000 Einbrüche und Einschleichdiebstähle registriert. Auffällig ist, dass Täter zunehmend in kürzeren Intervallen und professioneller vorgehen, was auf organisierte Gruppen hindeutet.
2. Kantonale Entwicklungen im Detail
2.1 Kantone mit deutlichem Anstieg
Besonders stark betroffen waren folgende Kantone:
-
Nidwalden: +93,8 %
-
Glarus: +56,3 %
-
Solothurn: +29,5 %
-
Luzern: +24,3 %
-
Freiburg: +23,8 %
-
Schaffhausen: +23,4 %
Luzern sticht hervor: Mit über 1.500 Einbrüchen wurde ein historischer Höchststand erreicht. Die Behörden berichten von organisierten Banden und fordern verstärkte internationale Polizeikooperation.
2.2 Kantone mit Rückgang
Andere Kantone verzeichneten trotz des allgemeinen Trends Rückgänge:
-
Graubünden: –29,8 %
-
Zug: –29,6 %
-
Appenzell Ausserrhoden: –28,0 %
-
Wallis: –15,4 %
-
Tessin: –15,1 %
-
Neuenburg: –1,6 %
Diese Kantone setzen erfolgreich auf Prävention, moderne Überwachungssysteme und erhöhte Polizeipräsenz.
3. Ursachen für die regionalen Unterschiede
3.1 Geografie und Demografie
-
Kantone an internationalen Grenzen und urbane Zentren sind besonders anfällig für „Einbruchstourismus“.
-
In dünn besiedelten Regionen wie Graubünden steigt für Täter das Entdeckungsrisiko.
3.2 Polizeistrategien und Prävention
-
Präventionskampagnen mit mobilen Beratungsstellen und Polizeipatrouillen zeigen Wirkung.
-
Zug und Graubünden setzen auf vernetzte Systeme zur Bewegungserkennung auf Privatgrundstücken.
3.3 Saisonale Schwankungen
-
Einbrüche nehmen im Spätherbst und Winter zwischen 16 und 20 Uhr zu.
-
In Tourismusregionen steigt das Risiko während Ferienzeiten.
4. Täterprofile und Vorgehensweise
4.1 Herkunft der Täter
Viele Tätergruppen stammen aus Südosteuropa, Südamerika oder Nordafrika und agieren sehr mobil.
4.2 Vorgehensweise
-
Hebelwerkzeuge reichen oft aus, um schlecht gesicherte Fenster und Türen aufzubrechen.
-
In Städten nutzen Täter häufig ungesicherte Balkone.
5. Präventionsmaßnahmen und Empfehlungen
5.1 Für Private
-
Türen und Fenster mit geprüften Schließsystemen sichern.
-
Anwesenheit simulieren (z. B. Licht- und TV-Simulatoren).
-
Nachbarschaftsnetzwerke stärken.
5.2 Für Gemeinden
-
Sicherheitszonen in Quartieren einrichten.
-
Informationskampagnen und Beratungstage anbieten.
-
Subventionen für technische Schutzmaßnahmen bereitstellen.
5.3 Für Unternehmen
-
Zutrittskontrollen und Videoüberwachung installieren.
-
Mitarbeitende für verdächtige Beobachtungen sensibilisieren.
-
Zusammenarbeit mit Sicherheitsfirmen fördern.
6. Polizeiliche Initiativen
6.1 Nationale Kampagnen
Die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) setzt Kampagnen wie „Zuhause sicher“ oder „Gemeinsam gegen Einbruch“ fort.
Apps wie Alertswiss informieren über Risiken und bieten Echtzeitwarnungen.
6.2 Internationale Zusammenarbeit
Die Polizei arbeitet eng mit Europol und Interpol zusammen und verstärkt die Grenzkontrollen an Hotspots wie Chiasso oder Basel.
7. Fallbeispiele
-
Luzern, März 2023: Eine Bande aus Osteuropa wurde nach über 30 Einbrüchen gefasst. Die Täter nutzten Mietwagen mit gefälschten Kennzeichen und spähte Opfer über Social Media aus.
-
Glarus, Frühjahr 2023: Nach einem starken Anstieg stoppte eine Taskforce „Sicherheit im Quartier“ die Einbruchserie durch gezielte Patrouillen und Präventionsmaßnahmen.
8. Medienberichte und öffentliche Wahrnehmung
Einbrüche sind medial stark präsent und belasten Betroffene emotional. Besonders ältere Menschen berichten von Angst und Schlafstörungen nach Einbrüchen.
9. Ausblick auf 2024
Die Behörden rechnen weiterhin mit hoher Kriminalität, bedingt durch internationale Faktoren wie Wirtschaftslage und Migration. Gleichzeitig versprechen Smart-Home-Technologien und KI-gestützte Prävention langfristige Entlastung.
Fazit
Die Einbruchszahlen 2023 zeigen, wie wichtig Prävention und Wachsamkeit sind. Regionale Unterschiede verdeutlichen, dass Sicherheit Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung, Polizei, Politik und Technologie erfordert. Kantone mit erfolgreichen Strategien können als Vorbilder dienen, um sichere Wohnumgebungen zu gewährleisten.